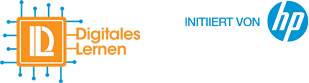Der erleichterte Zugang zu Tools auf der Basis von künstlicher Intelligenz (KI) leitete in den letzten zwei Jahren ein neues Zeitalter ein, das unterschiedliche Bereiche des Lebens erfasste. Von Anna Marczuk, Frank Multrus, Thomas Hinz und Susanne Strauß
Das Anfang 2023 aufkommende generative KI-Tool ChatGPT löste weltweit einen KI-Hype aus, der auch an den Hochschulen und im Studium eine zunehmende Zahl an Nutzenden fand (von Garrel et al., 2023). Der Einsatz von KI stellt die Hochschulen vor große Herausforderungen, weil sich komplett neuartige Möglichkeiten des Lehrens und Lernens ergeben. Ihr Einsatz wird die Arbeitswelt in Zukunft in vielen Tätigkeitsfeldern prägen, daher sollten Studierende aus Sicht von Politik und Wirtschaft einen verantwortungsvollen Umgang im Rahmen des Studiums erlernen (Reinmann, 2024). Im Bildungsbereich werden viele Chancen herausgestellt: KI-Systeme können Texte erstellen und überarbeiten, sie unterstützen als Ideengeber und Lernbegleiter beim Selbststudium (Albrecht, 2023). Als problematisch gilt, dass Kompetenzen verloren gehen und soziale Interaktionen gefährdet werden. Probleme werden des Weiteren beim Datenschutz, bei der Generierung von Falschaussagen sowie der erschwerten Messung von Eigenleistungen und damit zusammenhängenden Betrugsmöglichkeiten gesehen (Albrecht, 2023). Für die Hochschulen bedeutet dies, dass der verantwortungsvolle Einsatz generativer KI sinnvoll in die Studienprogramme eingebunden werde nmuss (Schwartmann, 2024). Ab Februar 2025 greifen bereits die ersten Vorgaben der europäischen KI-Verordnung, wonach Hochschulleitungen klare Regelungen formulieren und sicherstellen müssen, dass Hochschulangehörige sich der Chancen und Risiken bewusst sind und die Regelungen zumEinsatz von KI einhalten (Europäisches Parlament, 2024; Schmermund, 2025).
Verschiedene empirische Studien der letzten beiden Jahre haben gezeigt, dass Studierende künstliche Intelligenz im Studium bereits regelmäßig einsetzen (z. B. von Garrel et al., 2023; Hüsch et al., 2024; PERSONALintern, 2024; Preiß, et al., 2023; Schwartmann, 2024). Allerdings beschränken sich die meisten Studien auf einzelne Hochschulen oder ausgewählte Fächergruppen. Thematisch wurde dabei vorrangig auf die Nutzungshäufigkeit von KI und speziell ChatGPT abgestellt, seltener auf Einstellungen von Studierenden und auf Anwendungsgebiete (von Garrel et al., 2023). Dabei wurden bis dato zu wenig die Sicht von Studierenden in Hinblick auf die wahrgenommenen Chancen und Risiken sowie der reflektierte Umgang mit KI betrachtet. Zudem gibt es – bis auf einzelne Ausnahmen (z. B. Hüsch et al., 2024) – wenig Erkenntnisse darüber, inwiefern Hochschulen den Einsatz von KI durch Studierende regulieren und unterstützen.
Hier setzt die vorliegende Studie an. Mit einer bundesweiten Befragung von Studierenden zu Beginn des Wintersemesters 2024/2025 werden alle Fächergruppen Hochschularten abgedeckt. Es geht um die Häufigkeit der KI-Nutzung durch Studierende, die Anwendungsgebiete sowie wahrgenommenen Vor- und Nachteile und auch, wie die Hochschulen aus Studierendensicht die KI-Nutzung im Rahmen des Studiums regulieren und unterstützen. Dadurch ergibt sich ein Bild, ob und inwiefern Studierende die KI sinnvoll im Rahmen des Studiums einsetzen und wie ihre Wunschvorstellungen bezüglich des Einsatzes von KI und des Digitalisierungsgrads in ihren Studienprogrammen aussehen.
Befragungsdaten
Die Datengrundlage der vorliegenden Untersuchung ist ein Rapid-Response-Survey bei über 2.000 befragungsbereiten Studierenden im Oktober und November 2024. Der Feldzugang erfolgte über ein Online-Access-Panel. Der verwendete Datensatz ist im Hinblick auf wichtige Randverteilungen von Studierendenmerkmalen geprüft und gewichtet. Er ist geeignet für Zusammenhangsanalysen und die valide Auswertung von Surveyexperimenten (Hinz et al. 2023, 2024). Hinsichtlich einiger Aspekte (Bekanntheit und Nutzung von ChatGPT) kann auf eine Vergleichsbefragung mit identischem Design vom Juli 2023 zurückgegriffen werden.
Wie häufig nutzen Studierende KI-Tools im Jahr 2024?
Künstliche Intelligenz (KI) beschreibt Methoden, Verfahren und Technologien, die es ermöglichen, große Mengen von Daten zu interpretieren und aus diesen Daten zu lernen, um bestimmte Ergebnisse zu kommunizieren, die kognitive Fähigkeiten des Menschen nachahmen( Gilch et al., 2024). KI-Systemewie ChatGPT basieren auf generativen Modellen, häufig sogenannten Large LanguageModels (LLMs), die ausgehend von den zugrundeliegenden Daten (z. B. natürliche Sprache), mit denen sie trainiert wurden, neue Inhalte erzeugen können. Allerdings sind diese Sprachmodelle keine Wissensmodelle, sondern sie erstellen Texte „probabilistisch“, d. h. die Modelle sind darauf angelegt, Texte kontextbezogen und sprachlich korrekt, nicht aber zwingend faktentreu zu formulieren (IBM, 2023, 2024).
Die Ergebnisse zeigen, dass künstliche Intelligenz bei der Mehrheit der Studierenden bereits einen festen Platz im Studienalltag einnimmt: Zwei Drittel der Befragten nutzen KITools regelmäßig (Abb. 1). Dabei verwendet rund ein Viertel der Studierenden KI mindestens einmal im Monat, knapp ein Drittel mindestens einmal proWoche, und jede*r Zehnte greift sogar täglich darauf zurück.
Zusatzanalysen zeigen, dass Studierende, die KI regelmäßig im Studium einsetzen, sie mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in ihren Alltag außerhalb des Campus integrieren. Erwartungsgemäß zeigt sichweiterhin, dass häufige Nutzer*innen von KI-Tools auch ein besseres Verständnis für die Funktionsweise von KI (Large-Language-Modellen) angeben.
Am häufigsten und intensivsten nutzen die Studierenden der Informatik KI imStudium (77 % nutzen sie mindestens einmal monatlich/wöchentlich/täglich, siehe Abb. 2). Aber auch in den Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften berichten die Studierenden über eine rege Nutzung im Studium (jeweils circa 70 %). Bis auf zwei Ausnahmen nutzen mehr als die Hälfte der Studierenden in allen Fächergruppen KI imStudium.Nur in den Kunst- (46 %) und den Rechtswissenschaften (44 %) liegen die Anteile knapp unter der Hälfte und in der Medizin etwas über der Hälfte (52 %).
In Bezug auf konkrete generative KI-Tools zeigt sich, dass ChatGPT sich mittlerweile als das zentrale KI-Tool bei Studierenden etabliert hat (Abb. 3): knapp 90 % der Studierenden haben ChatGPT bereits einmal ausprobiert oder nutzen es regelmäßig. ChatGPT fungiert hierbei als eine Art „Alleskönner“, der sowohl für schnelle Rechercheanfragen als auch für komplexere Analyse- und Schreibaufgaben herangezogen wird. Andere „Alleskönner“ wie Gemini, Bing oder Perplexity kommen imVergleich dazu bei deutlich weniger Studierenden zum Einsatz (11 % – 21 % der Studierenden haben diese Tools bereits ausprobiert oder nutzen sie regelmäßig). Lediglich das KI-Tool DeepL, das auf Übersetzungen spezialisiert ist, wird von knapp der Hälfte der Studierenden regelmäßig genutzt oder wurde zumindest ausprobiert.
Ein Vergleich der Befragungsergebnisse der Erhebungen 2023 und 2024 unterstreicht die starke Dynamik und die zentrale Rolle von ChatGPT eindrücklich (Tab. 1):Während imJahr 2023 59 % der Studierenden ChatGPT nutzten,
liegt dieser Anteil aktuell bereits bei knapp 90 %. Zugleich hat sich der Bekanntheitsgrad des Tools deutlich verbessert: Lediglich 1%der Studierenden gibt im Jahr 2024 an, ChatGPT nicht zu kennen – ein signifikanter Rückgang gegenüber 2023, als knapp jeder zehnte Studierende keinerlei Kenntnis von ChatGPT hatte. Besonders eindrücklich ist die Steigerung der Nutzung von ChatGPT explizit für das Studium (Tab. 1). Während 2023 noch wenige Studierende ChatGPT für das Studium nutzten (30 %), hat sich dies 2024 deutlich geändert (81 %). Die Studierenden haben die Nutzungsmöglichkeiten von ChatGPT im Studium mit einer enormen Zuwachsrate erkannt.
Wofür nutzen Studierende KI-Tools?
In Bezug auf Anwendungsgebiete lässt sich festhalten, dass KI am häufigsten als Einstieg in ein Thema genutzt wird (Abb. 4): So verwenden 44%der Studierenden KI-Tools zur Klärung von Verständnisfragen und 37 % zur thematischen Einführung (sehr) häufig. Auch häufig greifen Studierende auf KI für Textverarbeitung zurück, die den Lese- und Schreibaufwand reduziert: Knapp 40 % der Studierenden lassen ihre bestehenden Texte mithilfe von KI (sehr) häufig überarbeiten und korrigieren bzw. übersetzen. Jeder dritte Studierende lässt sich (sehr) häufig sogar ganze Texte erstellen.
Im Gegensatz dazu wird KI für Literaturrecherchen nur von 26 % der Studierenden (sehr) häufig eingesetzt. Auch im Bereich des Zeit- und Studienmanagements (18%) oder bei der Erstellung von Präsentationen (15 %) kommen KI-Tools seltener zum Einsatz. Am seltensten werden sie für Programmierung, mathematische Aufgaben, Datenanalysen oder die Bilderzeugung genutzt (nur 14%- 19%der Studierenden nutzen KI dafür (sehr) häufig).
Weitere Analysen zeigen, dass die Studierenden KI nicht nur für ein Anwendungsgebiet, sondern für unterschiedliche Aufgaben einsetzen. Im Vergleich der Fächergruppen zeigt sich, dass Studierende der Informatik insgesamt am häufigsten verschiedene Anwendungsgebiete nutzen, danach folgen die Studierenden der Wirtschaftswissenschaften (vgl. Tab. 2). Vergleichsweise häufigere Nutzung ist auch bei jenen Anwendungen zu beobachten, die mit dem jeweiligen Studiumzu tun haben. So nutzen z. B. „textaffine“ Studierende der Geistes- und Sozialwissenschaften alle Anwendungsarten, die mit Texten zu tun haben, vergleichsweise häufig, während „zahlenaffine“ Studierende der Ingenieur- und Naturwissenschaften KI-Tools zur Programmierung und mathematischen Berechnungen häufiger nutzen. Studierende der Kunstwissenschaften weisen in vielen Anwendungsgebieten die geringste Nutzung auf, liegen bei der Bildgenerierung aber vorne (26 %).
Insgesamt zeigt sich, dass Studierende vor allem auf KI zurückgreifen,umsich einen Überblick über neue Themen zu verschaffen und ihre Texte sprachlich wie inhaltlich zu optimieren, während spezialisierte Funktionen oder Anwendungen außerhalb des textorientierten Bereichs deutlich seltener sind.
Welche Vor- und Nachteile sehen Studierende in der KI-Nutzung?
Viele Studierende nehmen künstliche Intelligenz vor allem als eine Erleichterung im Studienalltag wahr (Abb. 5). Mehr als die Hälfte sieht in der Nutzung von KI (sehr) große Vorteile darin, dass sie die Bearbeitung von Aufgaben beschleunigt (58 %) und bei Aufgaben unterstützt, die schwierig sind (62 %) oder keinen Spaß machen (56%). Häufig wird zudem als der (sehr) große Vorteil von KI-Tools angesehen, dass sie die Perspektive erweitern (53 %) und die Hemmschwelle senken, Fragen zu stellen (49 %). Das schlägt sich laut Angabe der Studierenden in einem höheren Wissenserwerbnieder (45 %).
Hinsichtlich der wahrgenommenen Auswirkungen auf Studienerfolge wird KI seltener als vorteilhaft gesehen: Vergleichsweise weniger Studierende sehen (sehr) große Vorteile von KI-Tools darin, dass sie die Noten (30 %) oder Qualität der Studienleistungen (35 %) verbessern. Insgesamt deuten diese Ergebnisse darauf hin, dass KI vor allem bei der schnelleren oder schwierigen Aufgabenbearbeitung sehr unterstützend wahrgenommen wird.
Trotz der häufigen Nutzung und deutlicher Vorteile stehen Studierende der KI gleichzeitig kritisch gegenüber (Abb. 6). Etwa die Hälfte der Befragten sieht (sehr) große Nachteile darin, dass KI-Systeme Fehler und Falschaussagen generieren sowie viele Betrugsmöglichkeiten im Studiumschaffen. Darüber hinaus sehen viele Studierende (sehr) große Nachteile in der Abhängigkeit von KI bei der Aufgabenbearbeitung (45 %) und im Verlernen des Verfassens von Texten (47 %). Im Gegensatz dazu empfinden deutlich weniger Studierende (sehr) große Nachteile darin, dass KI soziale Interaktionen verringert (26 %), was daran liegt, dass KI-Tools überwiegend im individuellen Selbststudium eingesetzt werden und somit Lerngruppen nicht ersetzen.
Interessanterweise unterscheiden sich diese Beurteilungen kaum nach Nutzungshäufigkeit. Zusatzanalysen zeigen, dass sowohl häufige als auch seltene Nutzer*innen von KI die potenziellen Nachteile ähnlich kritisch einschätzen. Dies zeigt, dass auch Studierende, die häufig KI-Tools im Studium nutzen, reflektiert mit diesen umgehen und sich der möglichen Risiken bewusst sind.
Von Studierenden aus nicht-akademischen Elternhäusern könnte behauptetwerden, dass sie mit dem sprachlichen Ausdruck auf akademischem Niveau Probleme hätten und deshalb auf KI-Tools häufiger zurückgreifen. Allerdings zeigt sich, dass Studierende mit mindestens einem akademischen Elternteil KI-Tools im Studium sogar etwas häufiger nutzen als Studierende ohne akademische Eltern. Keine Unterschiede treten hinsichtlich der Nützlichkeitseinschätzung auf. Studierende aus nichtakademischen Elternhäusern wenden KI nur etwas seltener für Überarbeitungen und Korrekturen an und sie sehen auch nicht häufiger einen großen Vorteil in der Verringerung eines nachteiligen sprachlichen Ausdrucks oder einer Verbesserung der Qualität ihrer Studienleistung. Studierende aus nicht-akademischen Elternhäusern sehen in der KI-Nutzung selbst also keinen gesteigerten Vorteil oder gar eine Notwendigkeit zur Aufwertung ihrer akademischen Leistungen, zumindest nicht mehr als Studierende aus akademischen Elternhäusern.
Studierende, die nicht in Deutschland geboren wurden und auch ihre Hochschulzugangsberechtigung (HZB) nicht in Deutschland erworben haben, nutzen KI im Studium zwar nur etwas häufiger, schätzen aber die Nützlichkeit deutlich häufiger als hoch ein (79 %) als deutsche Studierende (55 %). Für Korrekturen oder Texterstellung nutzen sie KI allerdings nicht häufiger, sehen aber etwas häufiger größere Vorteile in der KI-Nutzung für die Verringerung einer nachteiligen sprachlichen Ausdrucksfähigkeit (53 % zu 44 %).
Wie stehen Studierende dem Einsatz von Learning Analytics gegenüber?
Neben KI-Tools, die von Studierenden im Selbststudium eingesetzt werden, bestehen noch weitere Anwendungsfelder von KI, die von Hochschulen eingeführt werden. Ein Beispiel dafür ist der Bereich der Learning Analytics (LA). Hierbei werden Daten zum Lernverhalten und zum Lernfortschritt der Studierenden auf Plattformen wie Moodle oder Ilias von den Hochschulen erhoben, ausgewertet und genutzt,um den Lernprozess von Studierenden besser zu verstehen und gezielt zu optimieren.
Die Einstellung der Studierenden gegenüber Learning Analytics variiert dabei je nach Anwendungsziel (Abb. 7). Eine breite Zustimmung findet LA vor allem dann, wenn die gewonnenen Erkenntnisse genutzt werden, um Studierende direkt zu unterstützen. Die Mehrheit der Studierenden befürwortet den Einsatz von LA (sehr stark) bei Kurs- und Literaturempfehlungen (60%), bei der Vernetzung mit Studierenden (57%), bei der Erstellung personalisierter Studienpläne (53%) oder beim individuellen Feedback zu Aufgaben (53%). Etwas zurückhaltender reagieren die Studierenden hingegen auf den Einsatz von LA, wenn die Ergebnisse vorwiegend Lehrende unterstützen sollen, etwa als Orientierung zum Lernverhalten von Studierenden (44 %), der Zuordnung von Studierenden zu Kursplätzen (42%) und vor allem bei der Benotung von Studienleistungen (29%). Ebenfalls etwasweniger Zustimmung erfährt der Einsatz von LA auch dann, wenn die gewonnenen Daten an hochschuladministrative Stellen gehen sollen, etwa für die Studienberatung zur Studienabbruchprävention (36%) oder für die Auswahl von Studienbewerber*innen (21 %). Diese gestaffelten Reaktionen zeigen, dass die Akzeptanz von Learning Analytics vor allem dann stark ist, wenn der Nutzen für die Studierenden deutlich ist, weniger als Unterstützung für Lehrende oder für die Hochschulverwaltung.
Studierende an privaten Hochschulen unterstützen den Einsatz von Learning Analytics häufiger als Studierende an staatlichen Hochschulen. Besonders deutlich wird der Unterschied bei der Befürwortung der KI-gestützten Benotung von Studienleistungen (38 % zu 28 %), aber auch bei der Nutzung von KI für die Zuordnung von Studierenden zu Seminarplätzen (50%zu 41%) und zurOrientierung für Lehrende über das Lernverhalten der Studierenden (51 % zu 43 %). Hier könnte vermutet werden, dass private Hochschulen Learning Analytics bereits häufiger einsetzen, sodass die Studierenden deren Nützlichkeit bzw. Vorteile möglicherweise bereits erleben konnten.
Inwiefern unterstützen die Hochschulen Studierende in der KI-Nutzung?
Im Folgenden betrachten wir, inwiefern die Hochschulen ihre Studierenden bei der Nutzung von KI unterstützen. Wichtig ist dabei, dass es sichumSelbsteinschätzungen aus Sicht der Studierenden handelt – und nicht um eine Erfassung aus der Perspektive der Hochschulen. Nur eine Minderheit der Studierenden fühlt sich in der Nutzung generativer KI-Tools durch ihre Hochschulen unterstützt (Abb. 8). Etwa die Hälfte (51 %) gibt an, dass sie (eher) keine Unterstützung erlebt. Von einer (sehr) starken Unterstützung berichten lediglich 18%der Studierenden. Auch wenn die KI-Nutzung im Studium bei den Studierenden in weiten Teilen angekommen ist, stehen die Hochschulen aus Sicht der Studierenden eher noch am Anfang, was die gezielte Unterstützung der Studierenden angeht.
Allerdings finden sich durchaus Unterschiede bei der von Studierenden wahrgenommenen Unterstützung nach Hochschulart. So erfahren Studierende an denjenigen Hochschulen häufiger Unterstützung, in denen KI auch
häufiger genutzt wird: Studierende an Hochschulen für angewandteWissenschaften (HAW) erleben signifikant häufiger starke Unterstützung als an Universitäten (23 % zu 14 %), an denen KI etwas seltener zum Einsatz kommt (61%anUnis vs. 69%an HAWnutzen KI im Studium). Und Studierende an privaten Hochschulen erhalten deutlich häufigerUnterstützung als an staatlichen (35%zu 15%), die auch häufiger KI im Studium bereits nutzen (74 % zu 63 %).
Auf die Frage nach den konkretenMaßnahmen der Hochschule zur KI-Nutzung geben 68% der Studierenden an, dass ihre Hochschulemindestens eine der nachgefragten Maßnahmen (siehe Abb. 9) umsetzt. Das deutet darauf hin, dass die Hochschulen durchaus auf die Situation reagieren, allerdings scheinen die Studierenden nicht jede Maßnahme auch als starke Unterstützung zu bewerten.
Von den einzelnen nachgefragtenMaßnahmen erleben die Studierenden am häufigsten, dass die Hochschule klare Richtlinien zur Nutzung von KI herausgegeben hat (Abb. 9). Das bestätigen knapp 40%. Fast genauso viele Studierende erleben, dass Informationen über Möglichkeiten und Risiken von KI zur Verfügung gestellt werden (36 %).
Allerdings sind Richtlinien und generelles Informationsmaterial zwar wichtig und nützlich, doch lernen die Studierenden dadurch nicht die Nutzung von KI-Systemen. Dazu ist eine direkte Schulung besser geeignet: 28 % der Studierenden erhalten Schulungsangebote der Hochschule zur Nutzung von KI. Zudem berichtet ein Drittel der Studierenden davon, dass KI in manchen Lehrveranstaltungen integriert wird, sie also Teil der Lehre ist. Und 20 % der Studierenden berichtet, dass ihre Hochschule lernunterstützende KI-Tools zur Verfügung stellt.
Insgesamt kommen diese aktiven Unterstützungsangebote aus Sicht der Studierenden relativ selten an Hochschulen vor, vielmehr wurden bislang eher passiveMaßnahmen wahrgenommen (Formulierung klarer Richtlinien zur KI-Nutzung und Informationsbereitstellung zu Möglichkeiten und Risiken von KI).
Welche Maßnahmen sehen die Studierenden als gute Unterstützung an? Zusatzanalysen zeigen, dass das Angebot von Schulungsveranstaltungen den stärksten Zusammenhang zu der Wahrnehmung einer starken Unterstützung seitens der Hochschulen aufweist. Danach folgen die Integration in die Lehrveranstaltung, die Bereitstellung von KI-Tools und die Informationen zu Möglichkeiten und Risiken. Dagegen zeigen Richtlinien zur KI-Nutzung keine signifikanten Zusammenhänge mit der wahrgenommenenUnterstützung durch die Studierenden.
Die Nutzung von KI-Tools im Studium bietet den Studierenden breite Anwendungsmöglichkeiten und auch verschiedene klare Vorteile. Aber lässt sich auch zeigen, dass die Nutzung mit Selbsteinschätzungen zum Studienerfolg (etwa Zufriedenheit mit bisher erreichtem Wissen) zusammenhängt? Durch die Nutzung von KI kann Wissen vertieft und neu erworben werden. Analysen zeigen, dass die reine Nutzungshäufigkeit nicht mit den Selbsteinschätzungen des Studienertrags korreliert. Die Kenntnis der Funktionsweise und dieUnterstützung der Hochschulen in der KI-Nutzung gehen allerdings mit besseren Einschätzungen des Wissenserwerbs einher. Die Zufriedenheit mit dem erreichtenWissen und Können ist höher, wenn die Studierenden Unterstützung der Hochschulen in der Nutzung von KI im Studium erhalten undwenn sie die Funktionsweise besser verstehen.
Survey-Experiment mit Vignetten
Die in den Vigneten dargestellten hypothetischen Studienszenarien unterscheiden sich in verschiedenen Merkmalen, wie der Digitalisierung von Lehrveranstaltungen, dem Einsatz von KI in Lerngruppen, bei Hausarbeiten sowie als Unterstützung von Lehrenden bei der Benotung. Die Auswahl der Merkmale geht auf umfangreiche Pretests in der AG Hochschulforschung der Universität Konstanz zurück. Es bestehen insgesamt 48 Merkmalskombinationen (sog. full factorial oder kompletes Vignetenuniversum) (Auspurg & Hinz, 2015). Die Vigneten wurden den Befragten zufällig zugewiesen. Die Teilnehmenden bewerteten vier Vigneten und konnten auf einer elf-stufigen Skala angeben, wie atraktiv sie die dargestellten Studienmerkmale fnden: 0 „völlig unatraktiv“ bis 10 „sehr atraktiv“. In der Auswertung kann damit gezeigt werden, wie atraktiv die in den Vigneten beschriebenen Studienmerkmale im Hinblick auf KI-Einsatz oder Digitalisierungsgrad wirken. Die Urteile werden in der Auswertung nach Merkmalen der Befragten (Universitäts- vs. HAW-Studium, Geschlecht und Studienfach) kontrolliert. Um die Bedeutung der jeweiligen Merkmale zu beurteilen, werden die Regressionskoefizienten verglichen.
Die Auswertung erfolgt anhand einer multivarianten Regression, wobei der Zusammenhang zwischen der Atraktivitätsbewertung (abhängige Variable) und den oben genannten Studienmerkmalen (unabhängige Variablen) errechnet wird. Ausgewiesen werden die Modellkoeffizienten. Diese geben an, um wie viel sich die Punkte auf der Atraktivitätsskala verändern, wenn die unabhängige Variable eine andere Kategorie als die Referenzkategorie annimmt.
Beispielvignete mit Einleitungstext (fett markierte Studienmerkmale werden variiert):
Nachfolgend werden vier hypothetische Studienbedingungen kurz beschrieben. Wie atraktiv fänden Sie die Studienbedingungen in Ihrem Studienfach (Hauptfach)?
Die Lehrveranstaltungen werden ausschließlich online | in einer Mischung aus Präsenz und online | ausschließlich in Präsenz angeboten. (3)
Außerhalb von Lehrveranstaltungen lernen Sie in Lerngruppen mit Kommiliton*innen. | automatisierten Lernbuddys. (2)
Für Hausarbeiten dürfen Sie KI-Tools (z. B. ChatGPT etc.) nicht nutzen. | nur für die Recherche nutzen. | nur für die sprachliche Überarbeitung nutzen. | für die Recherche und die sprachliche Überarbeitung nutzen. (4)
Ihre schriflichen Leistungen werden von den Lehrpersonen ohne Unterstützung von KI benotet. | mit Unterstützung von KI benotet. (2)
Wie atraktiv wären diese Studienbedingungen in Ihrem Fach für Sie? (erhoben für jede der vier Vigneten)
0 „völlig unatraktiv“ – 10 „sehr atraktiv“
Survey-Experiment: Was wünschen sich Studierende bezüglich des Einsatzes von KI und der Digitalisierung des Studiums?
In den vorherigen Abschnitten wurden die aktuelle Nutzung von KI durch Studierende und ihre Einschätzungen zu Unterstützung von KI durch die Hochschulen dargestellt. Im Folgenden stellen wir die Frage, wie aus Sicht der Studierenden der optimale Einsatz von digitalen Elementen im Studium und speziell der KI aussieht. Insbesondere geht es um den Einsatz von KI bei der Erstellung von Hausarbeiten sowie innerhalb von Lerngruppen und bei der Benotung durch Lehrende. Ebenso wird der Grad der Digitalisierung der Lehrveranstaltungen in das Bild einbezogen. Hierzu haben wir ein Vignettenexperiment durchgeführt, in dem Studierenden vier hypothetische Studienszenarien – die je nach Digitalisierung und KI-Einsatz variieren – vorgelegt wurden (siehe Infobox Survey- Experiment). Diese Studienszenarien sollten Studierende im Hinblick auf ihre Attraktivität bewerten.
Um die Attraktivität der einzelnen KI-Dimensionen des Studiums zu identifizieren, wurde eine multivariate Regressionsanalyse durchgeführt. Die Ergebnisse sind in Abb. 10 dargestellt.Werte über nullweisen auf eine höhere Attraktivität beimVorliegen des jeweiligen KI-Merkmals hin (positiver Zusammenhang), während Werte unter null anzeigen, dass die Attraktivität der hypothetischen Studienszenarien bei Vorliegen des Merkmals reduziert ist (negativer Zusammenhang). Dabei ist der Abstand von der Nulllinie als über die Merkmale vergleichbare Effektstärke zu interpretieren. Zu beachten ist, dass für alle Merkmale die Koeffizienten auf eine Referenzkategorie zu beziehen sind.
Bei der Dimension Digitalisierung der Lehrveranstaltungen konnten Studierende drei Ausprägungen bewerten: Lehrveranstaltungen finden ausschließlich online, ausschließlich in Präsenz oder als eine Mischung aus beiden Formaten statt. Amattraktivsten bewerten Studierende das Studium,wenn Lehrveranstaltungen als eine Mischung aus Präsenz und online angeboten werden, dies ist aus Sicht der Studierenden attraktiver als Lehrveranstaltungen, die ausschließlich in Präsenz stattfinden (Abb. 10). Amwenigsten attraktiv sehen Studierende ein Studium an, in dem die Lehrveranstaltungen rein online angeboten werden. Anders ausgedrückt: Eine Teildigitalisierung der Lehrveranstaltungen ist von Studierenden erwünscht.
Bei derUnterstützung von KI für Hausarbeiten zeigt sich, dass der Einsatz von KI deutlich attraktiver ist als eine eigenständige Erstellung von Hausarbeiten durch Studierende ohne jegliche KI- Unterstützung (Abb. 10). Dabei wird KI sowohl für die Recherche als auch für die sprachliche Ausarbeitung der Hausarbeit als attraktiv angesehen,am bestenwird jedoch eine Mischung aus beiden Merkmalen bewertet.
Bei derUnterstützung von KI für Hausarbeiten zeigt sich, dass der Einsatz von KI deutlich attraktiver ist als eine eigenständige Erstellung von Hausarbeiten durch Studierende ohne jegliche KI- Unterstützung (Abb. 10). Dabei wird KI sowohl für die Recherche als auch für die sprachliche Ausarbeitung der Hausarbeit als attraktiv angesehen,am besten wird jedoch eine Mischung aus beiden Merkmalen bewertet.
Gegenüber dem Einsatz von KI bei der Benotung sind Studierende skeptischer: Hier finden es Studierende attraktiver, wenn Lehrende ohne jegliche Unterstützung von KI benoten (Abb. 10). Studierende bringen also offensichtlich bei der Notenvergabe dem Lehrpersonal ein größeres Vertrauen entgegen als der künstlichen Intelligenz.
Insgesamt zeigt sich, dass Studierende eine Teildigitalisierung der Lehre und eine Unterstützung durch KI bei der Erstellung von Hausarbeiten befürworten. Demgegenüber ist der KI-Einsatz für Lerngruppen oder für die Benotung durch Lehrende aus Studierendensicht weniger wünschenswert.
Von Anna Marczuk, Frank Multrus, Thomas Hinz & Susanne Strauß
Erstveröffentlichung:DZHW-Brief 02 2025(hier finden sich zugehörige Quellen und Abbildungen).