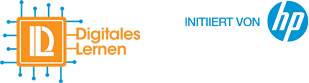Ein konsequentes Verbot der privaten Handynutzung während Unterricht und Pausen ist notwendig, muss aber eingebettet sein in Medienbildung und Elternverantwortung. Schule ist kein digitaler Marktplatz für soziale Netzwerke, sondern ein geschützter Raum für konzentriertes Lernen und direkte, menschliche Begegnungen.
„Ein Unterricht, der ständig durch digitale Reize gestört wird, kann seinen Bildungsauftrag nicht erfüllen. Deshalb fordern wir ein klares Verbot der privaten Handynutzung während Unterricht und Pausen in der Schule – und zwar verbindlich, nicht als Kann-Regelung. Andere Länder wie Dänemark zeigen längst, dass dies Konzentration und Lernerfolg massiv stärkt“, betont Martina Scherer, Landesvorsitzende des Philologenverbands Baden-Württemberg (PhV BW).
Die Diskussion dürfe sich jedoch nicht in Symbolpolitik erschöpfen. „Medienkompetenz heißt nicht, Kindern einfach Social Media zu verbieten. Sie müssen verstehen, wie Algorithmen ihre Aufmerksamkeit steuern, welche Relevanz sie wirklich haben und wie manipulative Mechanismen wirken. Nur so lernen sie, souverän und reflektiert mit digitalen Angeboten umzugehen“, erklärt die PhV-Landesvorsitzende. Und weiter: „Schule darf kein Spielball parteipolitischer Profilierung sein. Sie braucht endlich Rahmenbedingungen, die Lernen schützen, Begegnung ermöglichen und Medienbildung nachhaltig verankern.“
Zugleich erinnert der Verband der Gymnasiallehrkräfte daran, dass auch die Eltern in der Pflicht stehen, die ihren Kindern die Geräte zur Verfügung stellen. Die angemessene Nutzung privater Handys von Kindern und Jugendlichen sei Erziehungsaufgabe der Familien – Lehrkräfte hätten keine rechtliche Grundlage, Apps oder Inhalte auf Schülergeräten zu kontrollieren. Schulen bräuchten stattdessen einheitliche, verbindliche Regeln, die politisch getragen und gesetzlich abgesichert sind.
Der PhV BW betont, dass schulische digitale Endgeräte im pädagogisch geplanten Unterricht unverzichtbar sind – aber nur dann, wenn sie chancengleich als schulische Lehr- und Lernmittel zur Verfügung stehen, technisch betreut werden und Lehrkräfte rechtssichere Zugänge zu neuen Anwendungen, auch zu KI-Werkzeugen, erhalten. „Wenn die Matheaufgabe mit der Instagram-Nachricht konkurriert, verhindert das den Lernerfolg – deshalb brauchen wir klare Regeln“, so Martina Scherer abschließend.
Ansprechpartner: Philologenverband Baden-Württemberg